| Leitthema: |  | Energieeffiziente Fabriken |
| Thema: |  | ZBB = Zero Base Budgeting: Eine Methode, die Vergangenheit in Frage zu stellen! |
| Thema: |  | Fabrik des Jahres (Fortsetzung) |
| Thema: |  | HUMAN RESOURCES kontrovers Ist nicht jeder ersetzbar? |
| Hochschulnachrichten: |  | Bachelor und Master: Hat sich die Umstellung bewährt? |
| Praxis vor Ort: |  | Zu Gast bei VIESSMANN in Berlin |
Leitthema:
Energieeffiziente Fabriken
Prof. Dr.-Ing. Nicolas P. Sokianos
Nachdem wir uns in der Serienproduktion seit Jahren mit der Reduzierung der Verschwendung im Produktionsprozess befassen, ist es an der Zeit, uns sehr intensiv um die Energie zu kümmern. Sicher, es ist nicht so, als wäre das Thema neu. Neu und schmerzhaft sind die gestiegenen Energiekosten auch das Bewusstsein der Ökologie treibt zur Handlung. Der diesjährige Jahreskongress der Fabrikplaner, veranstaltet von der SVV- Süddeutscher Verlag Veranstaltungen GmbH, in Lud-wigsburg bei Stuttgart, wurde von über zweihundert Fachleuten besucht. Es ging nicht nur um "energieeffiziente Fabriken", sondern um Fabrikplanung überhaupt. Das Thema Energieeffizienz dominierte jedoch am ersten Tag und war auch am zweiten Tag durch den Besuch der Firma Dürr ebenfalls präsent.
Die Gründe für das Einsparen von Energie werden häufig von den Kosten getrieben; letztere machen den Standort Deutschland im internationalen Wettbewerb weniger attraktiv, das ist schon eine reale Gefahr. Die Erschließung und der Betrieb von Gewerbegebieten wird künftig stärker als bisher von den Energiekosten aber auch von der Versorgungssicherheit mit Energie geprägt.
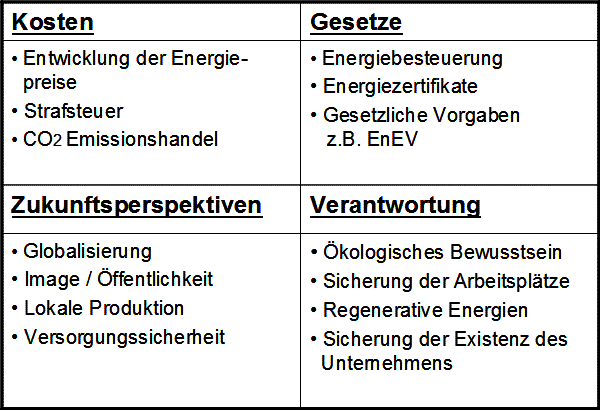 |
| Prägende Determinanten der Energieaspekte in der Fabrikplanung |
Ist der Energieeinsatz wertschöpfend?
Ein Energieflussdiagramm hilft sehr, die Augen vor der z.T. erheblichen Energieverschwendung zu öffnen. Dies ist auch nicht verwunderlich, denn das Energiebewusstsein ist im Vergleich zur Thematik "Zeit" und Zeitverschwendung meist unterrepräsentiert. Nach einer Darstellung von Freudenberg Sealing Technologies im "House of Energy" sind lediglich 16% des Energieeinsatzes wertschöpfend, 84% sind Muda (ein bekanntes Wort aus dem Lean Vokabular der Japaner, bedeutet "Verschwendung"!)
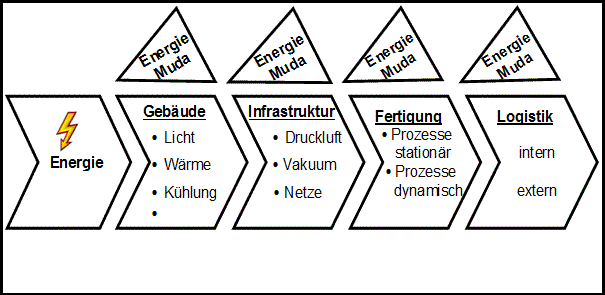 |
| Jeder Bereich trägt zur Energieverschwendung bei |
Was tun bei alter Infrastruktur?
Sicher, neue Produktionsgebäude, errichtet nach den modernsten Erkennissen des niedrigen Verbrauchs an Energie zu erreichen, gekoppelt um eine Mehrfachnutzung der in der gewärmten Abluft gespeicherten Energie, Nutzung von Geothermie und Solarenergie, sind aufwendig. Die im Kongress gezeigten Beispiele sind in einer Bandbreite von € 1000 bis € 1500 pro m2 realisierbar. Die energetische Sanierung von alten Gebäuden ist nicht nur die Aufgabe der technischen Gebäudeplaner. Die Verankerung eines Bewusstseins für den sparsamen Umgang mit der Energie sollte in der gesamten Belegschaft möglich sein, ist jedoch kein Selbstläufer. Dieser Prozess ist aktiv zu gestalten, mit geeigneten Kommunikationsmaßnahmen, mit ähnlichen Instrumenten, wie wir sie aus KVP-Prozessen und Workshops kennen.
Heute ist es sogar günstiger dieses Bewusstsein zu schaffen, als es vor 10 Jahren war, da jeder im privaten Bereich eine eigene und leidvolle Erfahrung mit den hohen Energiekosten hat, ob für Strom oder Benzin/Heizöl.
Sehr nützlich ist das gemeinsame Identifizieren von Energieeinsparungspotenialen. Das kann z.B. als Ergebnis bedeuten: die Abschaltung des Kaltwassers, die Abschaltung einzelner Anlagen am Wochenende und in der Nachtschicht, die Vermeidung von Stand-by Betrieb oder die intelligente Nutzung der Abwärme an wassergekühlten Druckluftkompressoren für Sanitärwasseraufbereitung (Freudenberg). Nicht zu vergessen die Regenwassernutzung zur Kühlturmnachspeisung oder für WC-Spülungen oder zur Parkbewässerung von Grünanlagen.
Solarenergie auf dem Dach der Fabrikhallen?
Die Physik hat bei diesem Punkt zusammen mit dem Controlling das Sagen. Wenn die bestehende Statik die zusätzlichen Lasten für die Solar-Paneele trägt, dann lohnt sich das Investment. Wenn aber nur deswegen eine Dimensionierung des Baukörpers stärker und somit deutlich teurer ausfallen sollte, dann ist eher davon abzusehen. Bei diesen Überlegungen sprechen wir immer von einer Fabrik in Deutschland mit den entsprechenden Sonnenstunden im Jahr.
Blockheizkraftwerk (BHKW)
Auch bei diesem Thema muss gerechnet werden. Die Investition von z. B. € 150.000 in ein BHKW, bei einer gesetzlichen Förderung/Einsparung von € 5,41 ct/kWh, muss die eigenen Strombedarfe decken, aber auch die generierte Wärme "verkaufen" können. Nicht zu vergessen die Instandhaltungskosten/Betriebskosten, die sich durchaus über die Nutzdauer erhöhen können.
 |
| Foto von N. Sokianos: Blick auf Gewerbegebiet / Fabrikanlagen |
LED Lichttechnik
Der technische Fortschritt macht es möglich, ganze Fabrikhallen mit LED-Flutern zu beleuchten. Das Einsparungspotential der LEDs gegenüber der Energiesparlampen liegt bei 45%; die sich daraus ergebenden Amortisationszeiten können bei drei Jahren liegen. Hierbei bietet die LED Beleuchtungstechnologie mehrere Vorteile im Bündel:
- Betriebswirtschaftliche (Senkung von Wartungskosten, Energiekosten)
- Volkswirtschaftliche (Einsparungspotenial Kosten/Einwohner)
- Technische (Dimmfähigkeit, flimmerfrei, Farbauswahl)
- Ökologische Vorteile (CO2 Reduktion, kein Quecksilber).
DÜRR im Zeichen der Energieeffizienz
Die interessierten Teilnehmer des Kongresses Fabrikplanung hatten die Möglichkeit, Praxis und Produkte vor Ort bei dem Unternehmen Dürr zu erleben. Mit 2,4 Milliarden Euro Umsatz (2012) und fast 24% EK ist der weltbekannte Spezialist für Lakieranlagen solide und gleichzeitig global aufgestellt. Erläuterungen zur Cleantech Strategie hat Herr Heubig gegeben, Finanzvorstand von Dürr und in Personalunion Geschäftsführer der Cleantech. Dürr setzt sich am Markt durch nachweisbare Reduzierung der benötigten Energie für das Lackieren eines Fahrzeuges von 1 MWH (USA alt) auf 430 kWh in neuen Fabriken in China durch. Daraus resultiert eine signifikante Kosteneinsparung pro Fahrzeug. Die Innovationsbreite und -tiefe, die das Unternehmen einsetzt und anbietet ist sehr bemerkenswert: Photovoltaik, Erdwärme / Wärmetauscher, Geothermie,….. alles im Zeichen "Energieeffizienz".
Lackierroboter werden weiterentwickelt und sehr erfolgreich vermarktet, kleinere Ausführungen erfolgen in Kooperation mit KUKA.
Abluftreinigung: Speziell für Industriebetriebe mit geringen Abluftvolumina wurde eine Kompaktanlage (Ecopure CTO) entwickelt, die in einen Standard-Frachtcontainer passt und nur ca. 20 m2 Fläche benötigt.
Fabrikelemente für die energieeffiziente Fabrik
Im Maschinenbau hat sich schon sehr lange der Begriff der "Konstruktionselemente" etabliert. Die Übertragung dieser Logik auf die Fabrik, also "Fabrikelemente," ist ein pragmatischer Weg des Autors, Standardisierung zu schulen und konzeptionellweiterzuentwickeln.
Fabrikplaner sollten sich vom Unikat "Fabrik" lösen, die Fabrik als Produkt auffassen. Diese Denkweise eröffnet neue Perspektiven. Der Trend zur energieeffizienten Fabrik wird anhalten. Fabriken werden sich deutlich verändern müssen.
 zum Seitenanfang (Themenauswahl)
zum Seitenanfang (Themenauswahl)
Thema:
ZBB = Zero Base Budgeting:
Eine Methode, die Vergangenheit in Frage zu stellen!
Prof. Dr.-Ing. Nicolas P. Sokianos
- Das Zero-Base-Budgeting ist in den USA von Pyhrr für Texas Instruments konzipiert worden, um dem Fortschreibungsdenken entgegenzuwirken und eine effiziente Ressourcenallokation zu erzielen.
- Die Planung beginnt jeweils bei NULL: Sämtliche Leistungen und Aktivitäten im Gemeinkostenbereich werden im Hinblick auf ihren Beitrag zur Erreichung der Unternehmensziele und die Kostenverursachung systematisch analysiert und in Frage gestellt. Aufgrund dieses hohen Aufwands sollte das Verfahren nicht in jeder Periode angewandt werden.
- Die Kernelemente dieses Verfahrens bilden die - auf Basis einer Funktionsanalyse gebildeten - Entscheidungseinheiten sowie die daraus abzu-leitenden Entscheidungspakete.
Gemäß Pyhrr ist ein Entscheidungspaket definiert als "a document that identifies and describes a specific activity in such a manner that management can evaluate it and rank it against other activities competing for the same or similiar limited rescources and decide whether to approve it or disapprove it".
- Zur Ableitung dieser Entscheidungsvorlagen für das Man-gement müssen zunächst die Ziele der jeweiligen Entscheidungseinheiten operationalisiert werden. Für jedes dieser Ziele werden dann unterschiedliche Leistungsniveaus vorgegeben.
- Danach erfolgt eine Bestimmung, Beschreibung und Analyse alternativer Verfahren zur Erreichung der definierten Niveaus. Auf Basis der vom Management zu erstellenden Rangordnung der Entscheidungspakete werden dann eine Ressourcenallokation sowie die weiteren Verfahrensschritte möglich.
 |
 |
 |
 zum Seitenanfang (Themenauswahl)
zum Seitenanfang (Themenauswahl)
Thema:
Fabrik des Jahres
Prof. Dr.-Ing. Nicolas P. Sokianos
Fortsetzung des Kongressberichts aus der Ausgabe März 2013
Christian Bleiel, GF von VW Polen, Polkowice
Seit 1999 wurden in das polnische Werk 350 Mio. EURO investiert. Dort werden TDI Motoren gebaut (Mindestlöhne sind in Polen bei 360 €, Anmerkung der Redaktion), VW zahlt einen Preis per Unit an die Dienstleister. 300 Lieferanten aus 20 Ländern beliefern das Werk, die Reichweite der Bestände ist kleiner als ein Tag, an den Linien: 15 Minuten.
Die Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Solidarnosc, ist gut, wenn auch nicht ohne Meinungsverschiedenheiten. "Die haben im Prinzip gleiche Ziele wie das Management", meinte Bleiel.
Die Zielvereinbarungen werden bis runter zum Schichtführer eingesetzt, jährliche Mitarbeitergespräche sind Pflicht.
Der Bonus geht bis zu 500 Zolty im Quartal, bei 50.000 Motoren sind maximal 5 Fehler erlaubt, darüber ist der Bonus weg, (500 ppm...).
Qualität: Jede Maßnahme hat einen Verantwortlichen und einen Termin, hohe Disziplin ist angesagt, sehr konsequent geführt, wenn dies erforderlich ist.
Kartonsimulation: Jede Linie wird in Pappe aufgebaut; in sogenannten 3 P Workshops können die Mitarbeiter aktiv die Planung mitgestalten.
"Wenn ich die Qualität gut im Griff habe, dann kommt die Produktivität von allein", meint, Bleiel.
AGFA: Meisterhafte Qualität bei Computer Radiographiegeräten
Frische Impulse kamen zu Beginn des zweiten Kongresstages von Agfa, Herr Herbert Klein, seines Zeichens Werkleiter und Leiter Produktion, hat einleitend über Werte gesprochen. Er praktiziert in seinem Werk eine sehr starke prozessorientierte Funktionsintegration, so gibt es keine Abteilung Einkauf, keine Abteilung Qualität mehr. Das Produktionssystem muss jeder verstehen, gleichwohl wird das Unternehmen über eine Balanced Scorecard geführt, geleitet anhand der abgestimmten Mission des Unternehmens. Der Kern ist die Montage von hochkomplexen Medizinprodukten, Computer Radiographiegeräte zum Beispiel. Klein ist der Meinung, dass es ohne Messung und Bewertung keine adäquate Entscheidungsfindung gibt. Sein Hintergrund als Controller für die gesamte Agfa Gruppe hat ihn vorgeprägt. "Blechverarbeitung kann man auch aus China oder Vietnam bekommen", das gibt Klein zu. Die Anforderungen bezüglich der Qualität, Toleranzen in der Medizintechnik, übertreffen die der Automobilindustrie bei weitem. Immer wieder thematisiert er den Menschen, ohne Rücksicht auf die Hierarchie, als Träger der Prozesse. Konsequenterweise sind die sozialen Kompetenzen sehr entscheidend, nicht nur die Fachkompetenz. Die Verbesserung der Gruppenarbeit ist Programm, das Lead Factory Concept sind nächste Herausforderungen.
 zum Seitenanfang (Themenauswahl)
zum Seitenanfang (Themenauswahl)
Thema:
HUMAN RESOURCES kontrovers
Ist nicht jeder ersetzbar?
Prof. Dr.-Ing. Nicolas P. Sokianos
Der Spruch "jeder ist ersetzbar" ist allgemein bekannt; er wird in Zeiten des Lean Management z.T. mit einem Unterton verwendet. Ein Blick hinter die Kulissen aus der Sicht des Personal- und Organisationsberaters ergibt jedoch sehr differenzierte Befunde. Fast so plötzlich und unerwartet wie Weihnachten ist der Termin des geplanten Ausscheidens eines Spezialisten oder einer Führungskraft da. In vielen Fällen hat kein fundierter Transferprozess stattgefunden, mal aus Geringschätzung der Beziehungen und des Wissens, mal aus Zeitmangel ein anderes Mal aus Mangel klarer Zuständigkeiten, da eine Reorganisation im Gange war.
A) Interner Wechsel zu einem anderen Bereich
Neue Zuständigkeiten können sich mehrfach als Zeitbombe entwickeln, etwa bei der Schaffung einer neuen Abteilung, die hinsichtlich ihrer Rolle und Funktion umstritten ist. Da bleiben teilweise die alten Aufgaben "hängen", die neuen kommen irgendwie dazu, als Leistungsbeurteilungs-Kriterien gelten unklare Ziele, Ressourcen sind nicht oder noch nicht verfügbar. Auf diesem Wege kann der Schaden vielfältig sein. Es kann zu Frustration und zu deutlichem Leistungsabfall führen oder zur Kündigung. Meistens gehen ja die Mutigeren und Effizienteren.
FAZIT: Ein Wechsel von Spezialisten zu einer anderen Abteilung oder zu einem anderen Bereich ist in mehreren Dimensionen gut vorzubereiten:
- Vorbereitung und Transfer in der alten Abteilung.
- Einarbeitung und Transfer in die neue Abteilung.
- Systematische Klärung der Interdependenzen, insbesondere der formal nicht definierten Rollen und Funktionen der Betroffenen! (Systemische Erinnerung, Historie, kulturelle Aspekte, insbesondere bei Wechsel in einen anderen Kulturkreis).
B) Ausscheiden aus dem Unternehmen
Bei diesem Fall muss differenziert werden zwischen:
- einem Wechsel in ein anderes Unternehmen und
- Wechsel in den (Un)ruhestand.
Der Fall 1. soll nicht an dieser Stelle vertieft erörtert werden, da dieses ein sehr komplexes Thema ist, das noch juristische Komplikationen mit sich bringen kann (z. B. im "gegenseitigen Einvernehmen", Wettbewerbsklauseln, etc.).
Fall 2. der vordergründig unproblematische Wechsel in den Ruhestand kann wiederum eine breite Palette von Optionen beinhalten: Der "Ruheständler" ist bereit, weiterhin dem Unternehmen zur Verfügung zu stehen. Bei Wissens- und Beziehungsträgern ist ein beidseitig nützliches Arrangement mach-bar, sodass ein Bruch vermieden wird. Es gibt allerdings auch kritische Konstellationen, wo aufgrund von persönlichen Animositäten diese Option verworfen wird. Hier ist eine integrative Führungskraft verlangt, die mit diplomatischem Geschick die Kontrahenten versöhnt, im Sinne des "Gemeinsamen". Will oder kann der Ruheständler nicht für das Unternehmen weiter tätig sein, so muss man das nicht nur akzeptieren, sondern die unter Punkt A) aufgeführten Hausaufgaben mit einer Vorlaufzeit von mindestens 12 Monaten gemacht haben. Die Tücke: Es bleibt immer mehr liegen, das auf den "letzten Drücker" erledigt sein will. Dabei können Organisationen im Personalbereich von den Logistikern lernen: Bei Produktwechsel ist eine meilensteingeführte Auslauf- und Anlaufsteuerung ein Muss, wird auch hinsichtlich des vermeintlichen Aufwandes gar nicht in Frage gestellt.
In allen Fällen ist eine würdige Verabschiedung unter Berücksichtigung des Status und der Verdienste angesagt. Eine konstruktive und durchdachte Trennungskultur macht den Unterschied!
Weiterführende Literatur
Wissenstransfer bei Fach- und Führungskräftewechsel:
Erfahrungswissen erfassen und weitergeben
Erlach, Orians, Reisach, Carl Hanser Verlag 2013, ISBN: 978-3-446-43458-5, € 39,90
Das Werk fokussiert auf die Weitergabe von Erfahrungswissen, sehr nützlich ist das Kapitel Methoden. Incl. E-Book-Reader,
Trennungskompetenz in allen Lebenslagen:
Vom Loslassen, Aufhören und neu Anfangen
Johanna Müller-Ebert, Kösel-Verlag 2007, ISBN: 978-3-466-30761-6. € 17,95
Moderation und Training
Haberzettl, Birkhahn, Beck-Wirtschaftsberater im dtv 2012, ISBN: 978-3-406-62650-0, € 17,90
Ein hochgradig lehrreiches Taschenbuch zum Thema Moderation sozialer Prozesse.
 zum Seitenanfang (Themenauswahl)
zum Seitenanfang (Themenauswahl)
Hochschulnachrichten:
Bachelor und Master: Hat sich die Umstellung bewährt?
Prof. Dr.-Ing. Nicolas P. Sokianos
Die Umstellung ist in der Zwischenzeit in den meisten Fachhochschulen und Universitäten erfolgt, Diplom-Studiengänge sind weitgehend durch das neue zweistufige System abgelöst.
Gleichwohl gehen die Meinungen in den Hochschulen / Unis sowie in der Industrie stark auseinander.
Der Bachelor ist ein berufsqualifizierender Abschluss, der in der Regelstudienzeit von 3,5 Jahren erreichbar ist. Eine kürzere Studiendauer soll künftig nicht mehr zugelassen werden; dennoch gibt es sechssemestrige Bachelor-Studiengänge. Diese sind meist der formale Anlass für abqualifizierende Äußerungen der Industrie "der ist nur geringfügig höher als der Facharbeiter bei uns". Dabei hat der Facharbeiter sehr wohl seine Berechtigung wie auch der gute Bachelor-Ingenieur. Schließlich klagt die Industrie über Nachwuchsmangel an Ingenieuren, da hilft es schon, motivierte Bachelor-Ingenieure einzustellen.
Training on the job haben früher die Diplom-Ingenieure schließlich auch benötigt. Leider gibt es tatsächlich Absolventen, die kaum einen Industriebetrieb von Innen gesehen haben, geschweige denn, ein mehrmonatiges, solides Arbeitspraktikum durchgeführt haben. Irgendwie sind sie zu ihrem Abschluss gekommen. Die sind sicher problematisch.
Den Master sollten gemäß der ursprünglichen Kapazitätsplanung lediglich 30 % der Bachelorabsolventen machen. Nur die Besten. Tatsächlich ist der Andrang viel höher, denn auch unter den Studierenden gibt es mit dem im Bachelor erlangten Wissen ein ungutes Gefühl. Also will man doch drei oder vier Semester weiterstudieren.
Der Präsident der Hochschul-Rektoren-Konferenz (HRK), Horst Hippler, vor Kurzem noch Wortführer der neun großen technischen Universitäten Deutschlands, ist ein Kritiker der Bologna Reformen. Der Bachelor, der taugt nach Hippler kaum als Ausbildung für den Beruf auf Universitäts-Niveau.
Ja, wer darf sich denn Universität nennen? Auch die ehemaligen Fachhochschulen, jetzt heißen sie alle "Hochschulen", im Englischen aber Universities! Den Titel tragen sie gerne und dürfen Master-Studiengänge anbieten, was einige mit großem Erfolg machen. Eine Domäne ist jedoch allein den klassischen Universitäten vorbehalten: die des Doktor-Ingenieurs.
Ein wesentliches Ziel des Bologna Beschlusses ist bisher weitgehend misslungen: die studentische Mobilität im Studium in Europa zu verbessern!
 zum Seitenanfang (Themenauswahl)
zum Seitenanfang (Themenauswahl)
Praxis vor Ort:
Zu Gast bei VIESSMANN in Berlin
Prof. Dr.-Ing. Nicolas P. Sokianos
Studierende der Fachrichtung Produktionstechnik Maschinen-bau sowie Wirtschaftsingenieurwesen an der Beuth Hochschule für Technik in Berlin hatten im Mai die Gelegenheit, sich über die Produktion und die Strukturen der VIESSMANN Werke in Berlin zu informieren. Eingebettet war der Werksbesuch in deren Fach "Fabrikplanung" (Prof. Dr. Sokianos). Seitens VIESSMANN informierten Herr Oppermann und Herr Stichert (vom Werk Mittenwalde). Der Werksrundgang wurde fachkundig von Herrn Kirmiss begleitet. Der Name VIESSMANN ist mit Heizkesseln für den privaten und gewerblichen Bereich verbunden, die Marke ist kürzlich mit einem Nachhaltigkeits-Preis ausgezeichnet worden.
 |
| Viessmann, Werk Berlin Foto von Herrn Uwe Oppermann, Viessmann |
Es ist sicher ein Glücksfall für die Stadt Berlin gewesen, dass die in Familienführung befindliche VIESSMANN Gruppe die Übernahme der ehemaligen Krupp Kesselfabrik in Rudow beschlossen hatte, die sich damals in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befand (1979). Einige Jahre später (1984) wurden die Werkhallen von IBM ebenfalls übernommen, die bis dahin Geldautomaten und Großplattenspeicher produzierten.
1991 kam das ca. 26 km entfernte Werk in Mittenwalde dazu, wo heute Anlagen in der Leistungsklasse 600 kW - 20 MW mit einer stark ausgeprägten kundenindividuellen Fertigung hergestellt werden.
 |
| Produktion von Heizkesseln Foto von Herrn Uwe Oppermann, Viessmann |
 |
| Heizkessel Foto von Herrn Uwe Oppermann, Viessmann |
Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, den z.T. automatisierten Herstellungsprozess zu sehen; ihre Fragen wurden bereitwillig von Herrn Kirmiss beantwortet. Ob U-Form-Konzeption, Handhabungsautomaten, Hochleistungspressen, Laserbearbeitungsanlagen oder die Schweißtechnologie, das Werk bietet viel, was das Herz der künftigen Ingenieure begehrt. Die Produkte selber können sich schließlich weltweit im scharfen Wettbewerb behaupten. 55% der generierten Leistung gehen in den Export, die Gruppe erwirtschaftet ca. 1,8 Milliarden Umsatz. An die Weiterbildung ist unter anderem auch mit einem Akademie-Konzept gedacht, Innovationen, Patente und eine hohe Qualität sichern die Zukunft.
Die Fabrikgebäude selber sind von den verschiedenen Bautechniken ihrer Zeit geprägt.
So finden sich sowohl die Shed-Dach-Konstruktion als auch Flachdach-Hallen mit Oberlichtern, die Materialflußtechnik bietet sowohl Schleppkettenförderer, Hallenkrane als auch die klassischen Standards des innerbetrieblichen Werksverkehrs. Die LKW Anlieferung, Be- und Entladung erfolgt innerhalb der Halle.
Auf einige interessante Detail-konzepte, wie z.B. das TPM für die Instandhaltung/ Werkserhaltung, ist angesichts des vollen Programms nicht eingegangen worden.
Die Fortsetzung des fachlichen Austausches bei einem nächsten Besuch oder bei Praktika, Bachelor- oder Masterarbeiten ist anvisiert.
 zum Seitenanfang (Themenauswahl)
zum Seitenanfang (Themenauswahl)
|
Prof. Dr.-Ing. Nicolas P. Sokianos Am Priesterberg 11 13465 Berlin GERMANY Tel.: ++49 (0)30 4373 1623 ++49 (0)30 4373 1624 FAX: ++49 (0)30 4373 1625 email: info@logicon.de |
© LOGICON: LOGICON ist eine eingetragene Marke von Prof. Dr.-Ing. Nicolas P. Sokianos